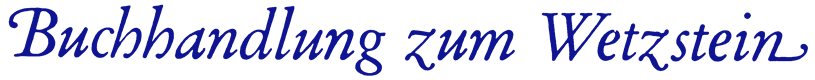Die Bücher des Monats sind unsere besonderen Bücher aus dem jeweiligen Wetzsteinbrief des Monats.
Verbrecher Verlag, 20 Euro „… Du gabst mir meine Flügel zurück. Du empfingst mich zugewandt. Du gabst mir das verlorene Haus zurück, am Ende des langen Weges der Flucht. Auch wenn ich nicht aus deinem Leib entstammte, Werde ich vielleicht doch noch ein Segen für dich sein Jetzt, da ich der Heimat fern bin, […]
Eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel. C. H. Beck Verlag, 28 Euro Der Altphilologe Grethlein, der an der Heidelberger Universität lehrt, hat nach Mein Jahr mit Achill mit dem neuen Band Hoffnung erneut ein wissensgesättigtes Buch vorgelegt, unterhaltsam und anregend geschrieben und voller eindrücklicher Beispiele. Grethlein durchwandert darin drei Jahrtausende westlicher Geistes- […]
Die Freundschaft zweier Überlebender – ein Doppelporträt. Rowohlt Verlag, 24 Euro
Lange nicht mehr hat mich ein Sachbuch so in seinen Bann geschlagen wie das vorliegende von Willi Winkler. Die beiden Herren Kissinger und Unseld, einen ehrgeizigen und skrupellosen Politiker und einen nicht minder ehrgeizigen Verleger, auf etwa 300 Seiten dermaßen kundig und gleichzeitig unterhaltsam gegenüberzustellen, ist große Kunst und eine beeindruckende Leistung. Auf diese Paarung muss man erst einmal kommen und dann den beiden so unterschiedlichen Charaktern auch noch gerecht werden! Winkler gelingt dies auf sehr überzeugende Weise, wieder einmal, wie bei ihm üblich, auf der Basis gründlicher und sorgfältiger Recherchen. Der Journalist, Autor und Übersetzer schreibt für die Süddeutsche Zeitung und außerdem wichtige Bücher wie u.a. Das braune Netzoder Herbstlicht. Er übersetzte u.a. Lebowitz‘ Buch für Kinder und phantasievolle Erwachsene Mr. Chas und Lisa Sue treffen die Pandas und Huxley‘s Reisebericht Along the Road.
Kissinger & Unseld ist sein neuestes Buch: interessant, spannend, lehrreich. Im Sommer 1955 auf dem Campus der Harvard University begegnen sich die beiden Ausnahmemänner zum ersten Mal und bleiben bis zu Unselds Tod einander verbunden. Es war Unseld, der den Kontakt immer wieder suchte und aufrecht erhielt, in seiner, wie wir dies aus anderen Büchern und von Zeitzeugen wissen, beharrlichen und konsequenten Art. Winkler auf seinem Weg durch beider Leben zu folgen, dabei Vieles und manch Neues über Politik und Kultur, Unternehmertum und ausgeprägtes Karrieredenken zu erfahren, ist ein großes Lese-Vergnügen. Winkler bewahrt immer kritische Distanz zu beiden Männern und wird ihnen dabei mit seiner Art zu schreiben auf besonders eindrückliche Weise gerecht. [SB]
80 Karten für die Welt von morgen. Rowohlt Verlag, 28 Euro
Der Erde ist es egal, was geschieht. Wir können weiterhin so leben wie bisher, aber am Ende zerstören wir uns selbst. Dies scheint in Gesellschaft und Politik noch nicht verstanden worden zu sein, trotz der vielen Texte, Analysen und Warnungen. Wenn der neu erschienene Klima-Atlas wohl auch nicht die große Erkenntniswende bringen wird, so kommt er trotzdem wie gerufen. Zumindest für jene, die Lust darauf haben, ein höchst komplexes Thema immer weiter zu entdecken und zu verstehen. Die beiden Autor:innen neben Luisa Neubauer haben hier, in 80 Karten, den aktuellen Ist-Stand wie auch die verschiedenen Veränderungsprozesse zusammengefasst. Und das anschaulich, verständlich und absolut erhellend!
Seit drei Wochen trage ich diesen Atlas mit mir herum, blättere, lese und entdecke immer wieder Neues und vieles Altes. Und mit diesen Karten wird so manche Fachliteratur verständlicher. Daher kann ich nur empfehlen, diesen Atlas zu lesen, Seite für Seite und dann mit anderen Büchern weiterzumachen, Klassikern wie auch Neuerscheinungen: Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome (1972) und den Nachfolgetext, Earth for All. Die Enzyklika Laudato si‘ (2014). Oder aktuelle Veröffentlichungen wie Was wahr ist (Carolin Emcke), Männer, die die Welt verbrennen (Christian Stöcker) oder Öl ins Feuer (Kathrin Hartmann). [BS]
Dies ist der zweite Roman des Autors Khani, der sich bereits mit dem Band Hund Wolf Schakal einen Namen machte. Unabhängig voneinander lesbar, entwickeln diese beiden herausragenden Bücher jeweils einen sehr eigenen Klang, sind geschrieben in einer Sprache, die sich der unterschiedlichsten Nuancen bedient. Khani schafft in Als wir Schwäne waren poetische Bilder von Gewalt und Überlebenskampf, ohne die Härte des Daseins in einer Siedlung im Ruhrgebiet der 90er Jahre zu beschönigen. Der Erzähler war zehn Jahre alt, als die Familie aus dem Iran nach Deutschland floh. Seine Mutter ist Soziologin, sein Vater Schriftsteller; sie alle sind auf der Suche. Wonach? „Wir sind ein Alptraum. Ich weiß nur nicht, wessen.“ In ihrer Sprache gibt es fünfzehn unterschiedliche Begriffe für Stolz. Wieviele gibt es im Deutschen? Der Junge rutscht immer weiter in eine Welt, in der Gewalt das maßgebliche Mittel ist, um sich zu behaupten, ja, er begibt sich aktiv in diese Welt, die seine Eltern nicht verstehen. Die unterschiedlichen Welten kollidieren, heftig und schmerzhaft für beide Seiten. Wir werden Zeuge dieser Unterschiede, erfahren beiläufig, äußerst treffend und genau erzählt, viel über deutsche Geschichte, über die deutsche Sprache, manches über den Iran. Wir lernen, was es bedeuten kann, niemals anzukommen. Mit dem Erzähler und dem Autor denken wir neu über den Begriff der Heimat nach – und die Unterschiede von Höflichkeit und Freundlichkeit, Interesse und Neugier. Auch, dass es in unserem Land zwar Beileid oder Mitgefühl gibt, aber kein Mitleid.
Ein großartiges Buch. Ein Buch, das bei jedem Wiederlesen seine Kraft und Schönheit neu entfaltet. [SB]
Behzad Karim Khani: Als wir Schwäne waren (Bestellen)
Hanser Berlin Verlag, 22 Euro
Herausgegeben von Jan Bürger, Gunilla Eschenbach, Anna Kinder, Helmuth Mojem und Sandra Richter. Deutsches Literaturarchiv Marbach, 18 Euro
Die marbacher magazine der Deutschen Schillergesellschaft sind immer wieder eine Entdeckung wert. Der neueste Band in dieser Reihe führt uns nach der klugen Einführung von Anna Kinder und Sandra Richter: Wie Literatur entsteht. Ein Blick hinter die Kulissenhinab in die Katakomben des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Wir wandern mit diesem Buch durch dessen Keller und damit hinein in die Geschichte von drei Verlagen: Cotta, S. Fischer und Suhrkamp. Anhand der Archive dieser Verlage, die dort gelagert und sorgfältig erschlossen wurden und, wie im Fall Suhrkamp, noch werden, ist ein umfassender Einblick in die Arbeitsweise dieser Häuser mit deren Autoren und Autorinnen möglich. Gegründet wurden sie von Johann Friedrich Cotta (1764 -1832), Samuel Fischer (1859 – 1934), Peter Suhrkamp (1891 – 1959). Der Suhrkamp Verlag wurde von Siegfried Unseld (1924 – 2002) maßgeblich vergrößert und prägend weitergeführt.
Der Aufstieg des Cotta Verlags wurde bestimmt von der großartigen Schaffenskraft seines äußerst geschäftstüchtigen Verlegers und der Strahlkraft Friedrich Schillers. Die Häuser Fischer und Suhrkamp litten unter dem verbrecherischen Nationalsozialismus. Holocaust, Exil, Konzentrationslager beherrschten die Bedingungen der Arbeit in den Verlagen.
Diese kämpften folglich nicht nur wirtschaftlich um ihre Existenz; ihre Leiter und Mitarbeiter*innen kämpften schlicht um das eigene Leben.
In den einzelnen Beiträgen dieses Bandes, in dem zusätzlich zahlreiche, bisher nicht bekannte Fotografien abgedruckt sind, erfahren wir ungemein viel Wissenswertes, also Wirtschaftliches, menschlich Berührendes, auch Randständiges, manches Liebenswürdige. 1950, am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, sprach Peter Suhrkamp in der Frankfurter Paulskirche. Seine bedeutende Rede anlässlich einer Buchwoche trug den Titel: „Kann das Buch uns helfen – müssen wir dem Buch helfen?“ Er schloss seinen Vortrag mit einem Rat, einem Wunsch: „Disponieren Sie in Ihrem Tagesplan eine tägliche stille Lesestunde ein.“ (S. 149) Was für ein guter Rat. Was für ein gutes marbacher magazin! [SB]
Das Buch können sie über post@zum-wetzstein.de bestellen.
Die Frage „Was kannst du an neuer Literatur empfehlen“ ist in meinem Freundeskreis nicht neu. Neu ist jedoch, wie ein Buch, das seit zwei Monaten bei mir liegt, immer wieder meine Besucher:innen fesselt und Begegnungen völlig verändert. Der Bildband Windsbraut mit Fotografien von Verena Brüning macht dies. Auf 127 Seiten, in kleinen bis zu doppelseitigen Bildern wird hier von der ersten Atlantiküberquerung einer Seefrauencrew auf einem Traditionssegler erzählt: stimmungsvoll, emotional und eindrücklich. Beigefügt sind zwei Texte und eine kleine Broschüre, die die Eindrücke der Bilder verstärken. Das Buch lädt ein zum Wegträumen, auf große Fahrt, über die Meere, denn mit diesen Bildern wird jeder zu einem Weltreisenden, der von seinen Reiseträumen erzählt. Ein wunderbarer Einstieg zu sehr persönlichen Gesprächen.
Aufgrund der Nachfrage nach diesem Bildband gibt es für Sie als Kund:innen acht reservierte Exemplare; bitte melden Sie sich daher zeitnah. Zusätzlich bieten wir Ihnen im Juli und August einzelne Bilder aus diesem Band gerahmt und/oder als Poster aus einer Kleinauflage der Fotografin an. [BS]
Bilderauswahl folgt
Menasse, der intelligente, große Verehrer, Bewunderer, Freund, Verteidiger unseres fragilen Kontinents Europa, hat ein mitreißendes Buch geschrieben, voller Witz, großem Wissen, auch mit manchen Widersprüchen, wie er selbst irgendwann im Text einmal belustigt feststellt. Es ist neben aller kritischen Betrachtung des Projektes Europa auch ein tröstliches und Mut machendes Buch geworden. Der Titel kommt nicht von ungefähr. Stefan Zweig ließ in seiner Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers das Wien der frühesten Jahre des 20. Jahrhunderts und die k. u. k. Monarchie Österreich-Ungarns, die Kultur des alten Europas, noch einmal vor unsere Augen treten, verbunden mit persönlichen Rückblicken auf sein eigenes Leben. Dieses Europa ging unter, versank in einem Blutbad, das die ganze Welt umfasste, ausgelöst von den Deutschen, geprägt von einem hemmungslosen Nationalismus, dem laut Menasse größten Unheilsbringer. Nach dem Ersten Weltkrieg konnten auch die entstandenen starken Friedensbewegungen nicht den folgenden Krieg verhindern, weil der „eigentliche Feind nicht infrage gestellt worden war, die Nation, als Idee und politisches Faktum.“ (Menasse, Seite 14). Wie Menasse es gelingt, Versäumnisse und Errungenschaften in Europa nach dem großen Scheitern und dem Wiederanfang einander gegenüberzustellen, das zu lesen ist Anregung und reines Vergnügen. Manche Politiker*innen bekommen ihr Fett gehörig weg, immer dann, wenn sie den nach Menasse logischen nächsten Schritt in der Demokratiegeschichte nicht machen wollen, den in eine nachnationale europäische Demokratie. Wir lernen: „Demokratie ist mehr als Wählengehen auf der Basis eines national definierten Stimmrechts“. Eine gute Denkanregung für den 9. Juni 2024 in einem höchst unterhaltsamen, anregenden und spannenden Sachbuch. [SB]
Robert Menasse: Die Welt von morgen (Bestellen)
Suhrkamp Verlag, 23 Euro